Abschnitt 5 TRD 301 Anlage 1 - Zulässige Spannungen und Lastwechselzahlen (1)
5.1. Spannungsgrenzen bei bekannter Lastwechselzahl
5.1.1.
Ist nur die Anzahl n der vorgesehenen oder zu erwartenden Kaltstarts angegeben, so ist die Anriß-Lastwechselzahl  >= 5 × n zugrunde zu legen, damit genügende Reserven für Warmstarts sichergestellt werden (siehe TRD 301 Nummer 6.2.1). Ist dagegen ein Lastwechselkollektiv, bestehend aus n1 Kaltstarts und n2, n3, ... Warmstarts (mit gegebenenfalls unterschiedlichsten Anfangs- und Endzuständen) gegeben, so sind die Anriß-Lastwechselzahlen
>= 5 × n zugrunde zu legen, damit genügende Reserven für Warmstarts sichergestellt werden (siehe TRD 301 Nummer 6.2.1). Ist dagegen ein Lastwechselkollektiv, bestehend aus n1 Kaltstarts und n2, n3, ... Warmstarts (mit gegebenenfalls unterschiedlichsten Anfangs- und Endzuständen) gegeben, so sind die Anriß-Lastwechselzahlen  1,
1,  2,
2,  3 usw. so zu wählen, daß Gl. (25) erfüllt wird.
3 usw. so zu wählen, daß Gl. (25) erfüllt wird.
Für die Lastwechselzahlen  1,
1,  2 usw. müssen nach Nummer 5.1.2 die reduzierten Schwingbreiten ermittelt werden.
2 usw. müssen nach Nummer 5.1.2 die reduzierten Schwingbreiten ermittelt werden.
5.1.2.
Für ungekerbte Stäbe sind noch Bild 8 die zulässigen Schwingbreiten 2 a, in Abhängigkeit von der Anriß-Lastwechselzahl n zu bestimmen. Diese müssen für Bauteile wegen Oberflächeneinflüssen reduziert werden. Dies erfolgt durch den Korrekturfaktor f3 nach Tafel 1 und ergibt
a, in Abhängigkeit von der Anriß-Lastwechselzahl n zu bestimmen. Diese müssen für Bauteile wegen Oberflächeneinflüssen reduziert werden. Dies erfolgt durch den Korrekturfaktor f3 nach Tafel 1 und ergibt
 (11)
(11)
Diese Schwingbreite 
 * ist folgender Korrektur zu unterziehen,
* ist folgender Korrektur zu unterziehen,
(1) Im elastischen Falle 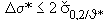 ist eine Korrektur erforderlich, um den Einfluß der größtmöglichen Mittelspannung zu berücksichtigen. Man erhält unter Verwendung der Gerber-Parabel die zulässige reduzierte Schwingbreite der ideal-elastischen Spannungen
ist eine Korrektur erforderlich, um den Einfluß der größtmöglichen Mittelspannung zu berücksichtigen. Man erhält unter Verwendung der Gerber-Parabel die zulässige reduzierte Schwingbreite der ideal-elastischen Spannungen
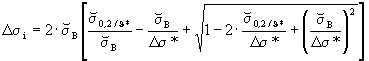 (12)
(12)
(2) Im überelastischen Falle  ist zu berücksichtigen, daß man in Wirklichkeit mit einer größeren Dehnung als der im idealisierten elastischen Fall rechnen muß. Es gilt dann
ist zu berücksichtigen, daß man in Wirklichkeit mit einer größeren Dehnung als der im idealisierten elastischen Fall rechnen muß. Es gilt dann
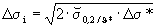 (13)
(13)
5.1.3.
Sind die zulässigen reduzierten Schwingbreiten 
 i für die einzelnen Lastzyklen ermittelt, so müssen die zulässigen Oberspannungen
i für die einzelnen Lastzyklen ermittelt, so müssen die zulässigen Oberspannungen  i, und die zulässigen Unterspannungen
i, und die zulässigen Unterspannungen  i, festgelegt werden, mit denen
i, festgelegt werden, mit denen  i während des An- und Abfahrens zu begrenzen ist und schließlich die zulässigen Temperaturdifferenzen zu berechnen sind.
i während des An- und Abfahrens zu begrenzen ist und schließlich die zulässigen Temperaturdifferenzen zu berechnen sind.
Da die Spannungsgrenzen für die einzelnen Zyklen durch die Wahl der An- und Abfahrgeschwindigkeit beeinflußbar sind, kann man sie in einem gewissen Bereich frei wählen. Hier empfiehlt sich  über einen Beiwert
über einen Beiwert  wie folgt festzulegen:
wie folgt festzulegen:
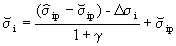 (14)
(14)
 >= 0 ist das absolute Verhältnis der zulässigen Wärmespannung bei Abfahrbeginn zur zulässigen Wärmespannung bei Anfahrbeginn. Wenn bei Abfahrbeginn nicht nur die Temperatur, sondern auch der Druck abgesenkt wird, das Bauteil dabei nicht regelmäßig durch zusätzlich eingeleitetes kälteres Medium gekühlt wird und zwischen Kesselhersteller, Besteller und Überwacher nichts anderes vereinbart wird, kann mit
>= 0 ist das absolute Verhältnis der zulässigen Wärmespannung bei Abfahrbeginn zur zulässigen Wärmespannung bei Anfahrbeginn. Wenn bei Abfahrbeginn nicht nur die Temperatur, sondern auch der Druck abgesenkt wird, das Bauteil dabei nicht regelmäßig durch zusätzlich eingeleitetes kälteres Medium gekühlt wird und zwischen Kesselhersteller, Besteller und Überwacher nichts anderes vereinbart wird, kann mit  = 0 gerechnet werden. In diesem Fall ist also
= 0 gerechnet werden. In diesem Fall ist also 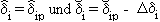 .
.
Ansonsten wird die Oberspannung  (15).
(15).
5.1.4.
Bei wasserberührten Teilen aus nicht austenitischen Stählen muß auf die Erhaltung der Magnetitschutzschicht besonders geachtet werden. Für diese Teile werden daher die Spannungsgrenzen zusätzlich wie folgt eingeschränkt:
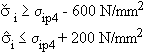 (16);(17)
(16);(17)
5.1.5
Die Gl. (14) bis (17) ergeben die zulässigen Ober- und Unterspannungen für die einzelnen Lastzyklen. Aus diesen lassen sich mit den Gl. (8) und (10) die zulässigen Temperaturdifferenzen beim An- und Abfahren wie folgt berechnen:
Anfahren:
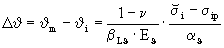 (18)
(18)
Abfahren:
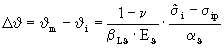 (19)
(19)
5.2. Zulässige Lastwechselzahl für gegebene Spannungen.
5.2.1.
Sind für einen Lastzyklus die Spannungsgrenzen  1, und
1, und  1 bekannt, so läßt sich die Anriß-Lastwechselzahl für diesen Zyklus wie folgt ermitteln:
1 bekannt, so läßt sich die Anriß-Lastwechselzahl für diesen Zyklus wie folgt ermitteln:
Ausgehend von der vorhandenen Spannungsschwingbreite
 (20)
(20)
gilt
(1) für den überelastischen Fall 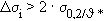
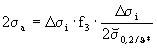 (21)
(21)
(2) für den elastischen Fall 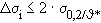
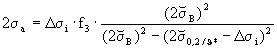 (22)
(22)
Mit dem Wert 2 a wird die Anriß-Lastwechselzahl
a wird die Anriß-Lastwechselzahl  aus Bild 8 entnommen.
aus Bild 8 entnommen.
Die zulässige Lastwechselzahl ergibt sich hieraus für alleinige Kaltstarts zu n= /5.
/5.
Für Lastwechselkollektive sind die zulässigen Lastwechselzahlen n1, n2, n3, ..... so zu wählen, daß Gl. (25) erfüllt ist.
5.2.2.
Für Vorausberechnungen können die Spannungsgrenzen  i und
i und  i ausgehend von den Temperaturänderungsgeschwindigkeiten
i ausgehend von den Temperaturänderungsgeschwindigkeiten  , und
, und  unter der Annahme quasistationärer Verhältnisse, wie folgt abgeschätzt werden:
unter der Annahme quasistationärer Verhältnisse, wie folgt abgeschätzt werden:
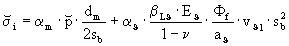 (23)
(23)
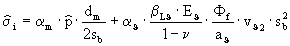 (24)
(24)
Die Ergebnisse nach Gl. (23) und (24) liegen auf der sicheren Seite, weil die maximale Wärmespannung und die maximale mechanische Spannung ohne Berücksichtigung einer zusätzlichen Phasenverschiebung addiert werden. Für genauere Berechnungen ist die tatsächliche zeitliche Zuordnung zu beachten.
5.2.3.
Bei wasserberührten Teilen dürfen  i und
i und  i die unter Nummer 5.1.4 festgelegten Grenzen nicht überschreiten, was gegebenenfalls durch Begrenzung der ideal-elastischen Wärmespannungen zu erzielen ist.
i die unter Nummer 5.1.4 festgelegten Grenzen nicht überschreiten, was gegebenenfalls durch Begrenzung der ideal-elastischen Wärmespannungen zu erzielen ist.
